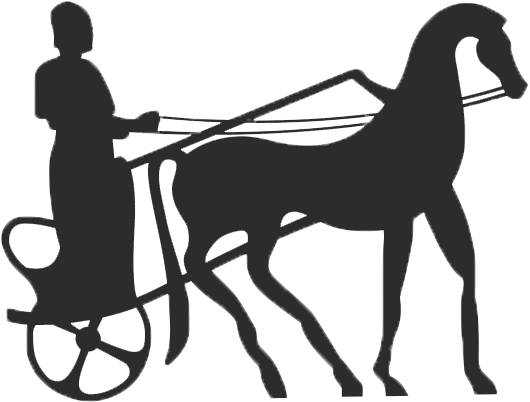Das Besucherprogramm vom Projekt “Jüdisches Leben in Frankfurt” lädt seit 1984 jährlich Zeitzeugen und ‑zeuginnen nach Frankfurt ein und lässt auch Schulen an einem Austausch über ihr ehemaliges Leben in Frankfurt teilhaben. Seit einigen Jahren werden auch Zeitzeugen der “zweiten Generation” eingeladen; so kamen die Geschwister Susan und Carrie Berman sowie ihre Partner ans Lessing-Gymnasium und berichteten Schülern und Schülerinnen der Q 2 (dem Leistungskurs Englisch von Frau Haberstock und dem Grundkurs Geschichte von Herrn Kern) über ihre Familiengeschichte.
Das Besucherprogramm vom Projekt “Jüdisches Leben in Frankfurt” lädt seit 1984 jährlich Zeitzeugen und ‑zeuginnen nach Frankfurt ein und lässt auch Schulen an einem Austausch über ihr ehemaliges Leben in Frankfurt teilhaben. Seit einigen Jahren werden auch Zeitzeugen der “zweiten Generation” eingeladen; so kamen die Geschwister Susan und Carrie Berman sowie ihre Partner ans Lessing-Gymnasium und berichteten Schülern und Schülerinnen der Q 2 (dem Leistungskurs Englisch von Frau Haberstock und dem Grundkurs Geschichte von Herrn Kern) über ihre Familiengeschichte.
Zwei Minuten vom Lessing entfernt befindet sich die einstige Schule (die Elisabethenschule) ihrer 1927 in Frankfurt geborenen Mutter Hannelore Oppenheimer, später Laura Berman. Sie wuchs hier auf, doch als Adolf Hitler sein judenfeindliches Regime etablierte, wurde es mehr als nur schwer, weiter in Frankfurt zu leben.
Plötzlich waren Hannelore, ihr Bruder Karl-Heinz, ihre Mutter Bertha Weil und ihr Vater Karl Zacharias Oppenheimer Staatsfeinde, ohne je etwas getan zu haben. Hannelore musste von der öffentlichen Elisabethenschule auf die private, jüdische Philanthropin wechseln. Doch auch damit endete die Gefahr nicht. Und so wanderte Hannelore mit ihrer besten Freundin Marianne im Jahre 1938 aus, erst über die Niederlande und England bis sie schließlich in die USA kommen. Hannelores Vater, der zuvor verhaftet wurde, kam 1939 mit ihrer Mutter nach. Karl-Heinz floh nach England, wurde dort aber später deportiert. Die Familie ließ sich in New York nieder, doch beiden Elternteilen war es nicht mehr möglich, ihre beruflichen Karrieren fortzusetzen. So wurde Hannelore im Alter von gerade einmal 17 Jahren der Hauptverdiener der gesamten Familie.
Auch Susans und Carries Vater war aus Deutschland geflohen, in seinem Fall sind die Details allerdings nicht so klar wie bei Hannelore. Die Geschwister erzählen allerdings, dass er alleine geflohen war und erst einige Jahre später durch einen Cousin, der in Berlin verblieben war, über die Deportation seiner Eltern herausfand. Weitere Jahre später erfuhr er nach intensiver Recherche in Amerika und Deutschland dann über ihren Tod. Mit dem Schuldgefühl überlebt zu haben trug er sein restliches Leben mit sich.
Während ihrer Lebenszeit redeten beide Elternteile nicht gerne über ihre Vergangenheit. Denn obwohl es schien, als seien sie der größten Gefahr entkommen und könnten nun in Frieden leben, fühlten sie sich auch in Amerika unsicher. Der Vater, so berichteten Susan und Carrie, hielt daran fest, dass Juden überall deportiert werden könnten. Sie lebten also weiterhin in Angst und distanzierten sich daher so weit wie möglich zu Deutschland. Die einzigen Bindeglieder, die sie zu ihrer einstigen Heimat hielten, waren weitere deutsche Migranten in New York.
Ihre negative Ansicht Deutschlands gaben sie auch an Susan und Carrie weiter. Susan erzählt, dass sogar bei Zugfahrten, die durch Deutschland führten, Angst in ihr aufkam und sie bei Europa-Reisen den Besuch Deutschlands so weit wie möglich zu vermeiden versuchte.
Ihr Vater kam, nachdem er über den Tod seiner Eltern erfuhr, nicht mehr nach Deutschland zurück und starb recht früh. Und auch ihre Mutter hätte Deutschland wahrscheinlich nie wieder betreten, wenn es nicht für das Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt gewesen wäre. Mit ihrer Freundin Marianne zusammen besuchte sie 1994 ihre Heimatstadt wieder. Leider verstarb auch sie fünf Jahre später. Sie hinterließ jedoch jegliches Besitztum, welches sie aus Deutschland mitgebracht hatte, ihre Schulbücher, Zeugnisse und alte Fotos. All dies stellten Susan und Carrie uns vor.
Auf diese Vorstellung folgten unsere Fragen und die NS-Zeit kam verständlicherweise als ein bedeutendes Thema auf. Susan erklärte, dass wir uns zwar in einer progressiven Gesellschaft befinden, es aber in bestimmten Situationen wie dem Ukraine-Krieg oder auch bei der Wahl Trumps beinahe wieder zu aussehen würde, als kehre man zu den Grausamkeiten der NS-Zeit zurück. Und obwohl wir von einer progressiven Gesellschaft sprechen, seien Phänomene wie Rassismus oder Antisemitismus noch lange nicht ausgestorben. Zu diesen scheinen sie sogar genauso präsent, wie in denjenigen Zeiten aus denen wir lernen wollten. Und diese Phänomene träten überall auf. Von daher reiche es nicht aus, nur zu sagen, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat. Man müsse sich intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen, Fehler erkennen und sie konfrontieren, um jeden Preis eine Wiederholung der Vergangenheit zu verhindern. Erst dann könne man tatsächlich davon sprechen, dass man aus Fehlern gelernt hat und sie niemals wiederholen möchte. In diesem Zusammenhang wiesen die Geschwister sehr anerkennend und lobend auf den kritischen Umgang Deutschlands mit der eigenen Geschichte hin.
Für den Mut nach Deutschland zu reisen und ihre Bereitschaft eine schmerzhafte Geschichte nachzuerzählen, danken wir als Lessing-Gymnasium vielmals und hoffen, dass wir eines der vielen Beispiele werden können, die sich für den Kampf gegen Diskriminierung aller Art, sei es wegen Aussehen, Herkunft, Sexualität oder Glauben, einsetzen.
Vielen Dank an Susan und Carrie Berman!
Und vielen Dank an das Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt!
Naomi Ahmed (Q2)